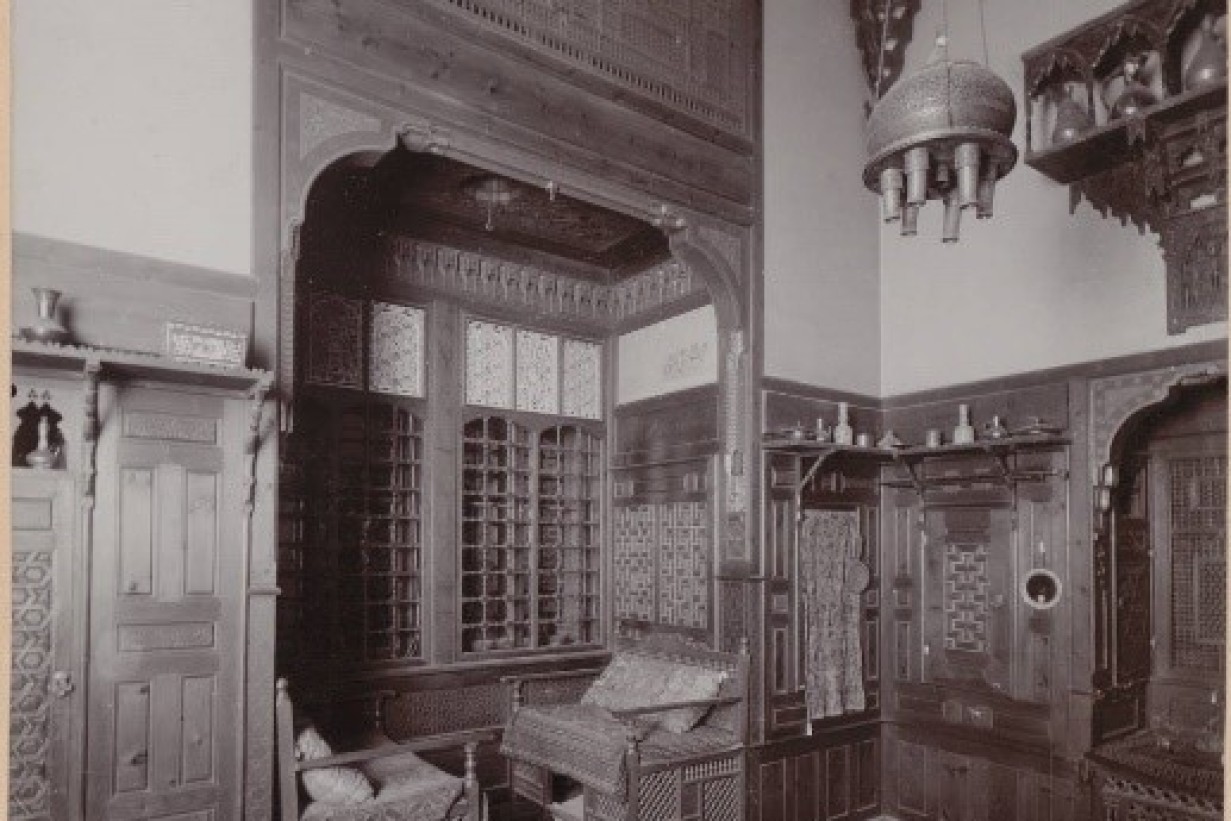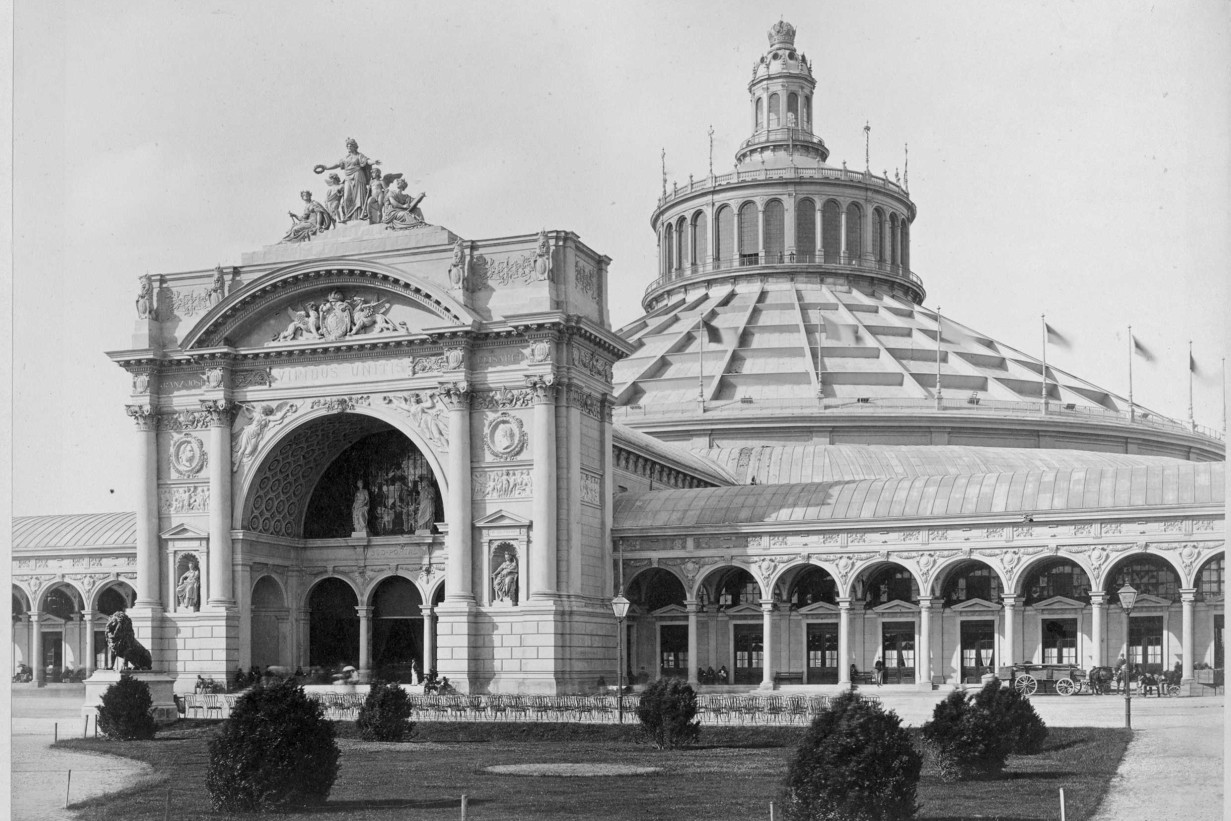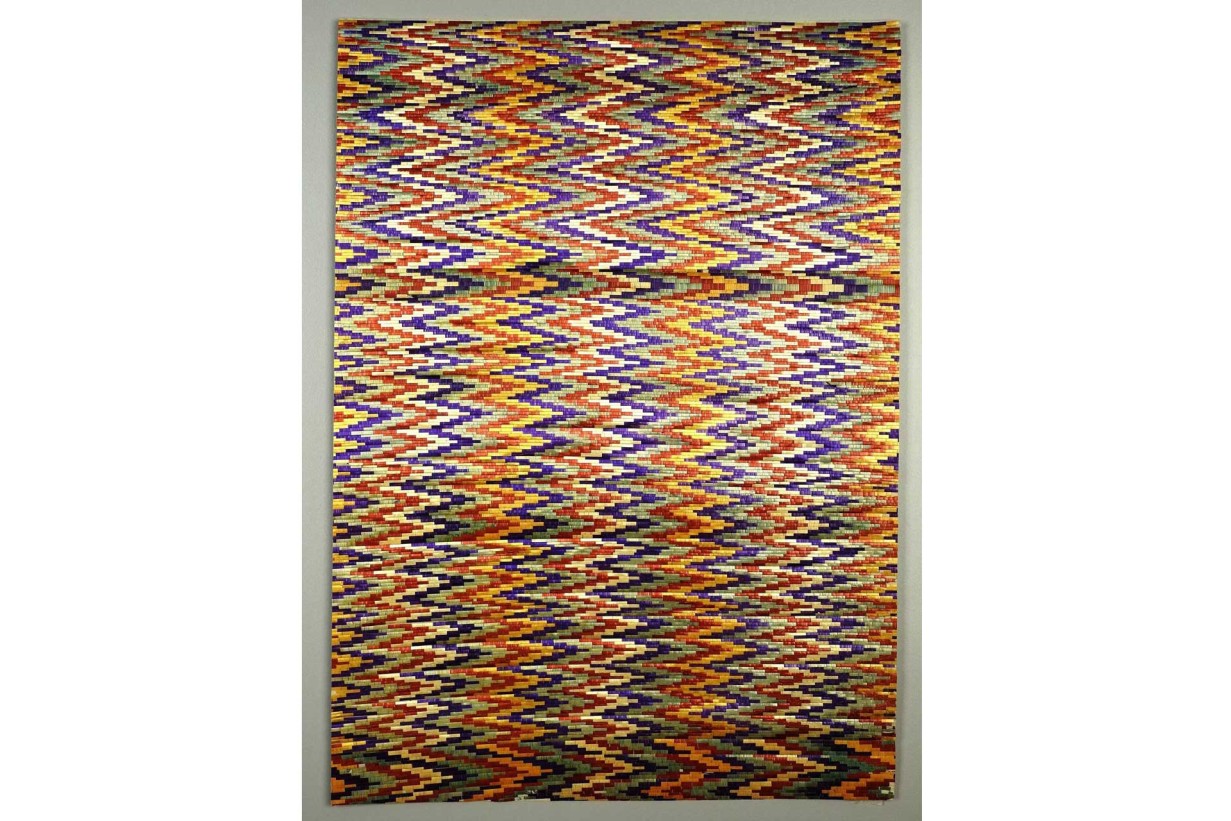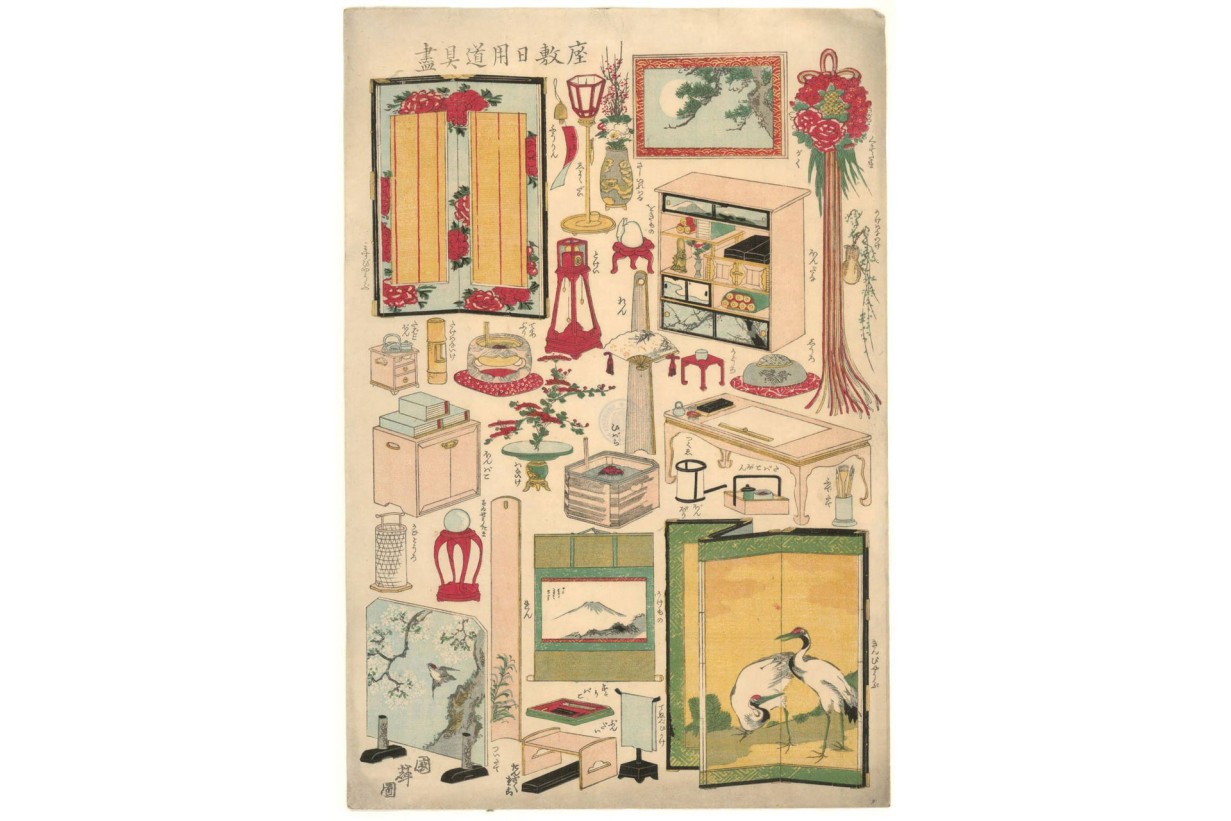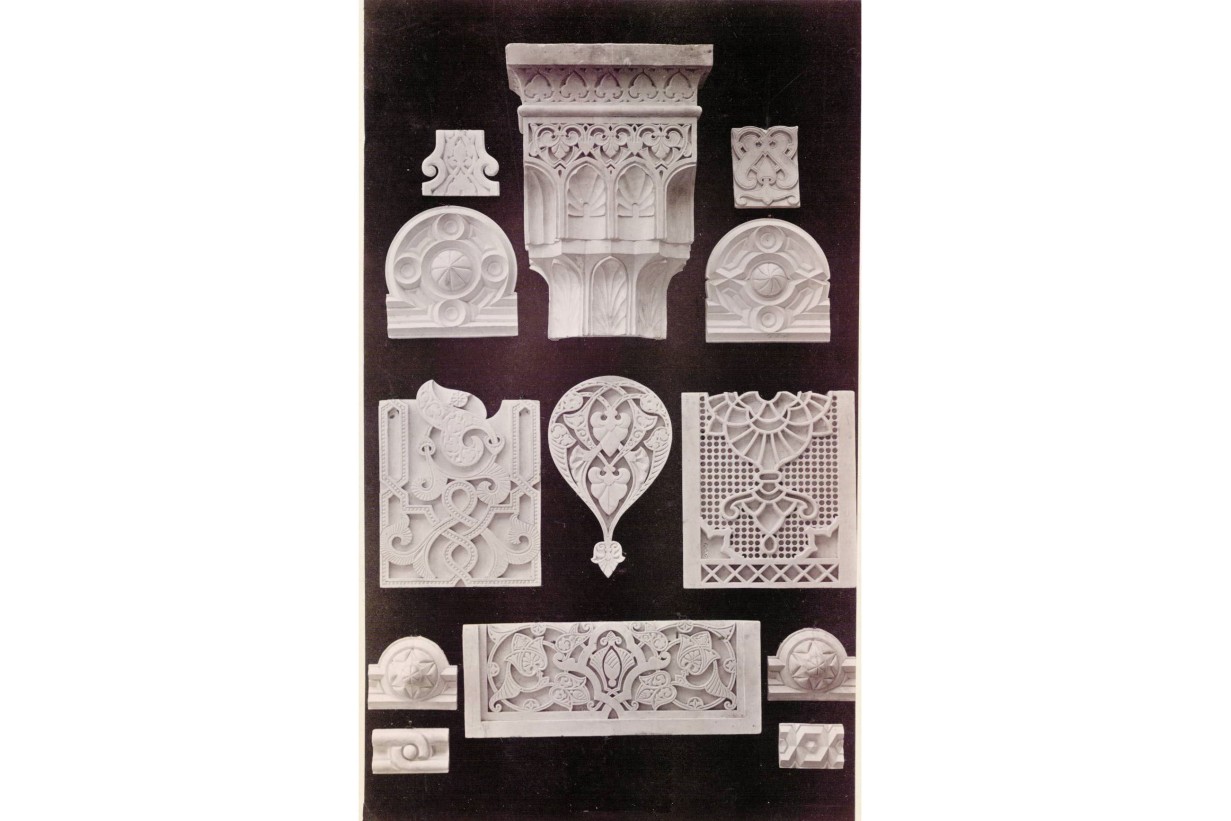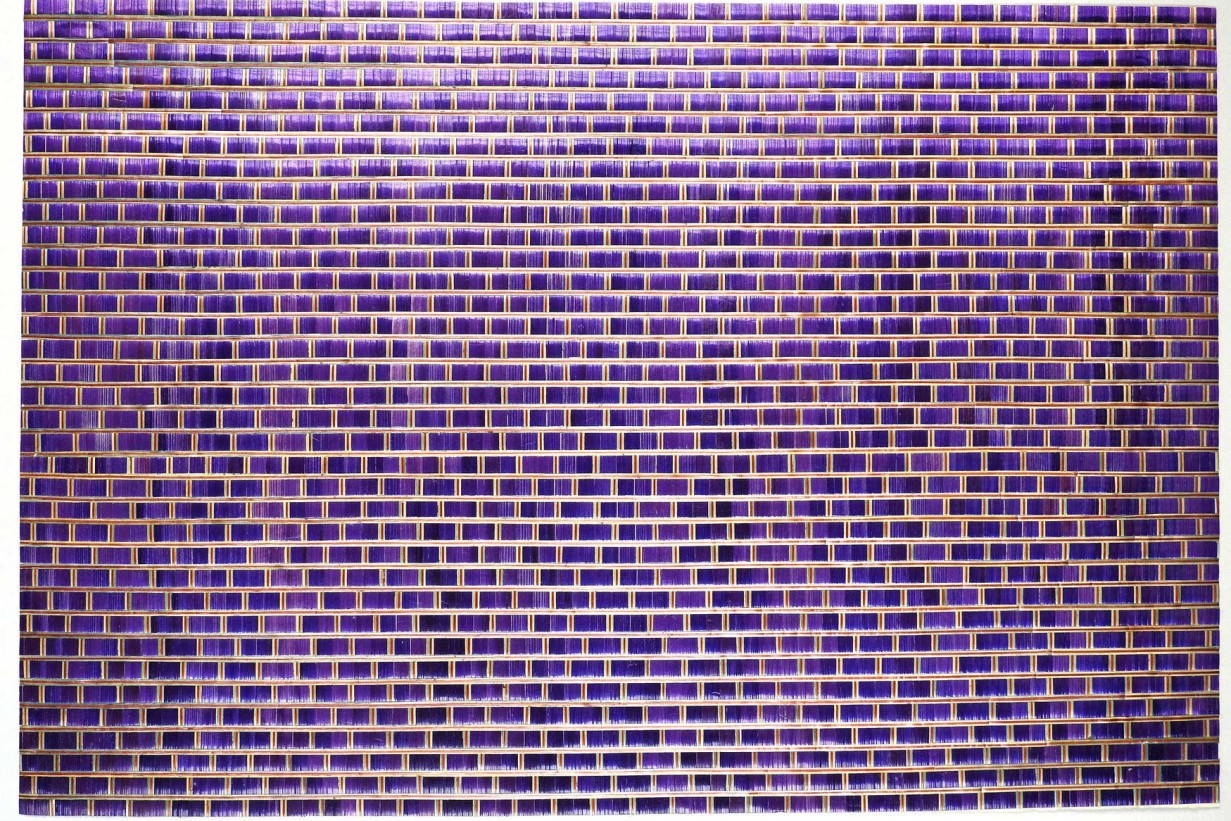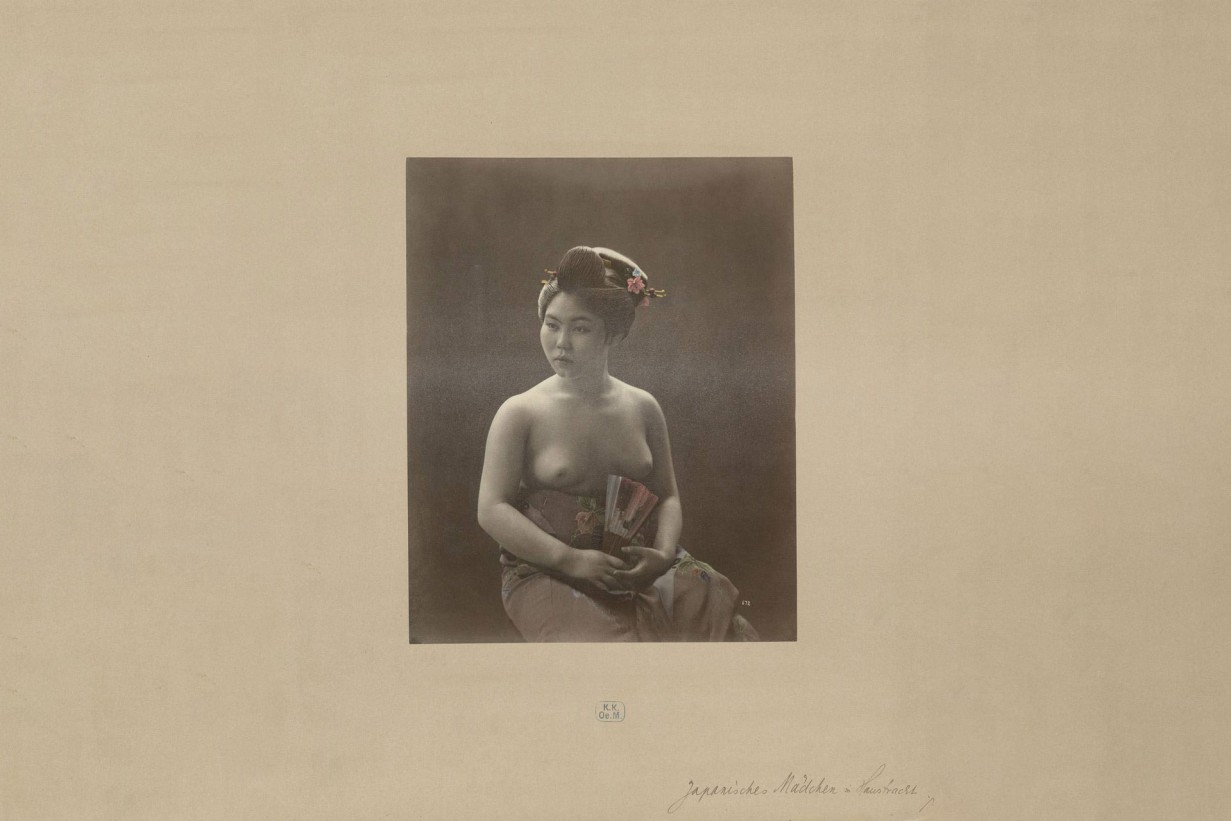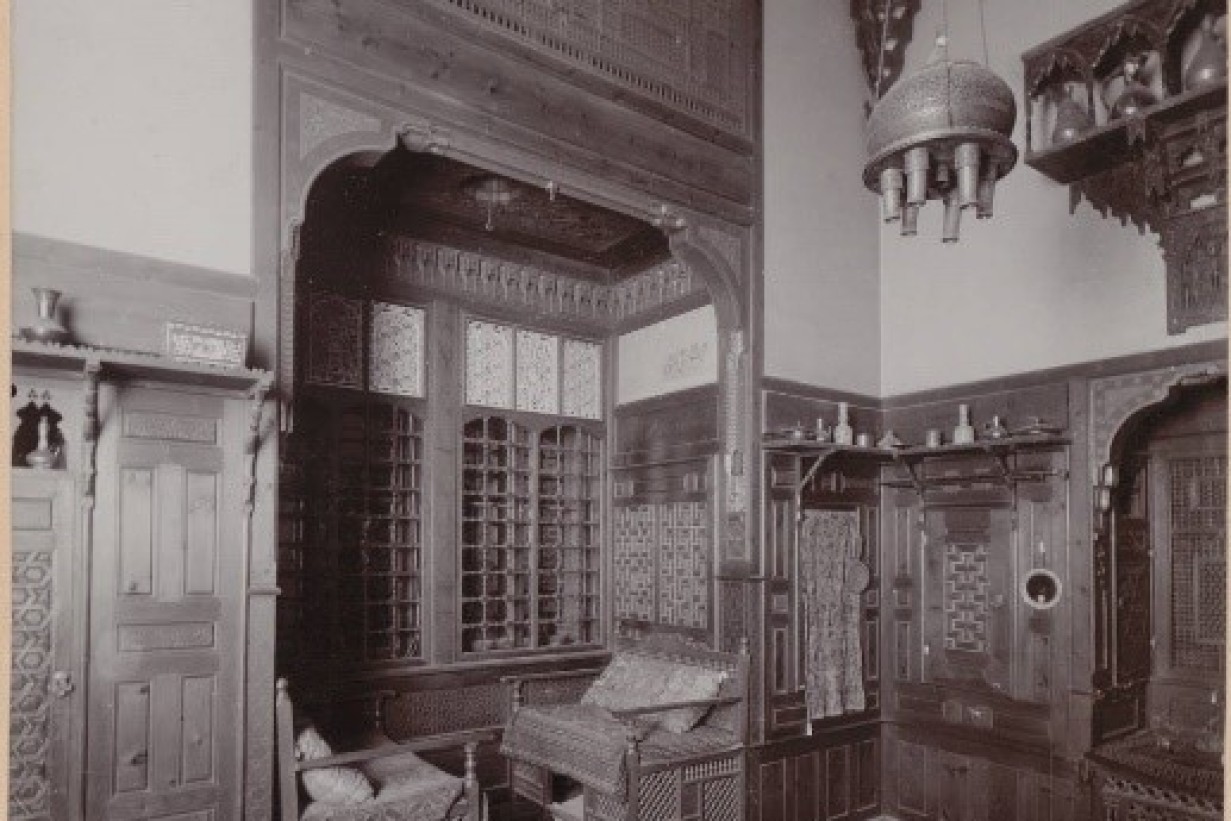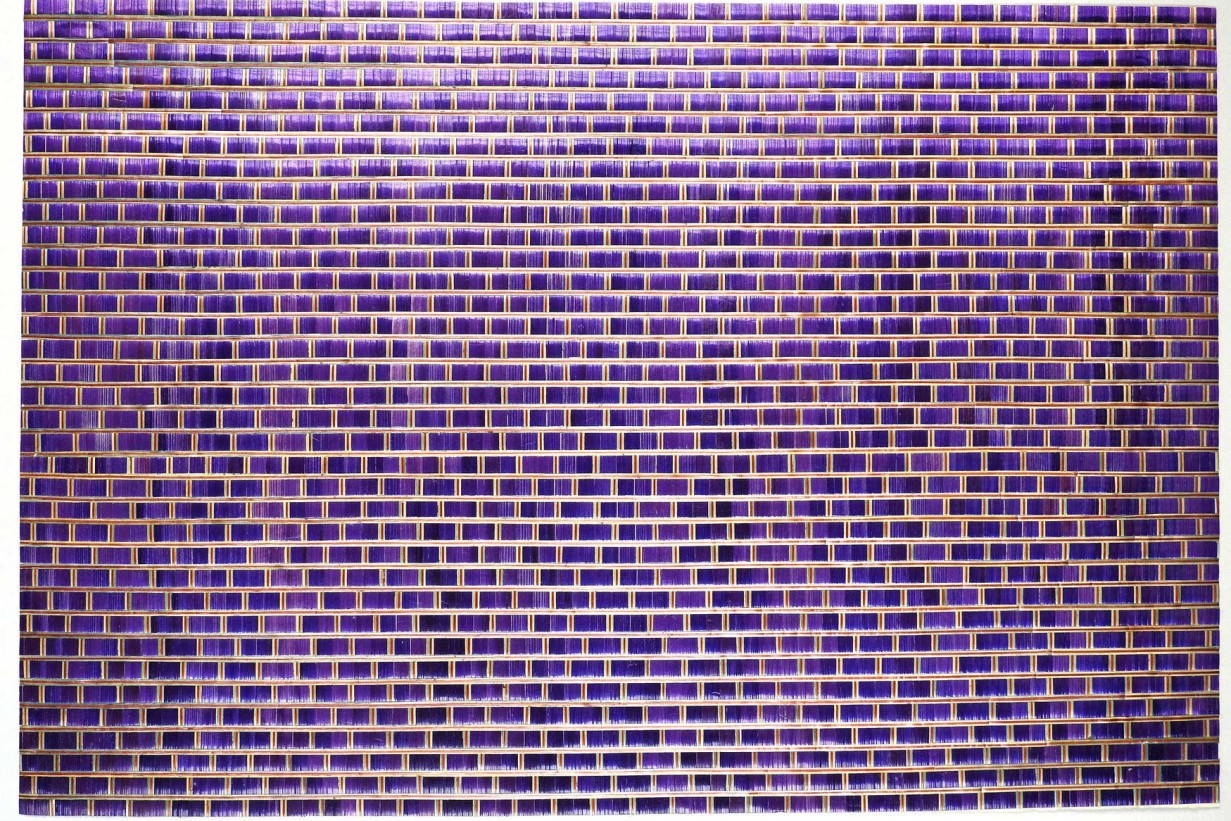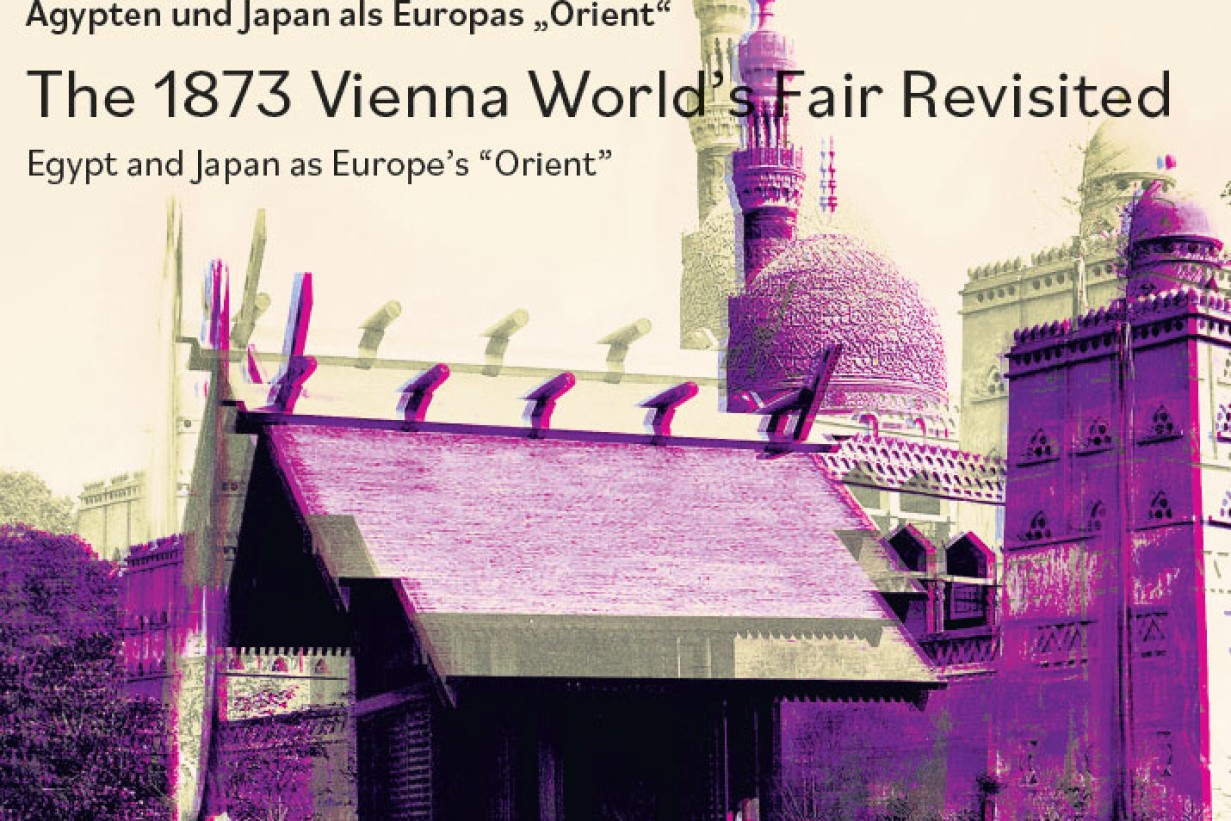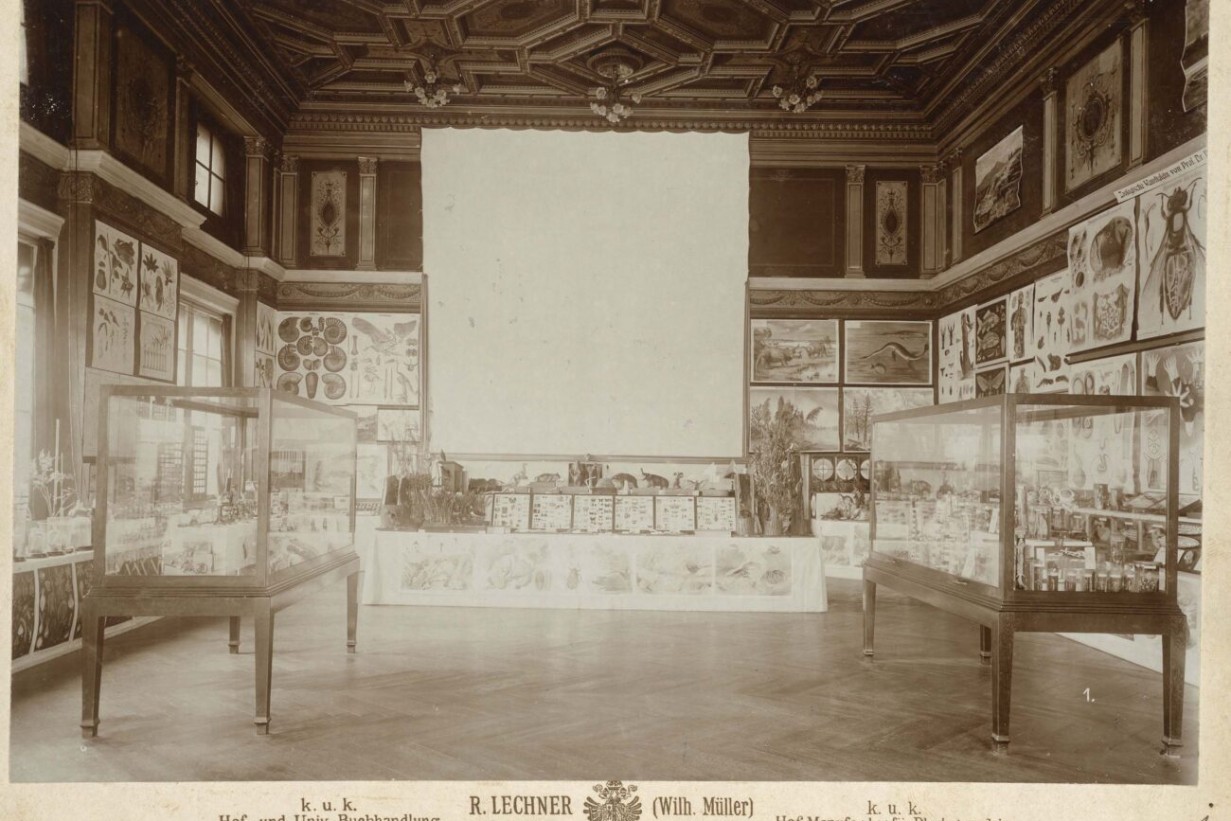Ägyptische Baugruppe und japanischer Garten, Wiener Photographen-Association, Wien, 1873 © MAK
Ansicht der Rotunde der Wiener Weltausstellung 1873 © MAK
IKEDA Taishin, Wanddekoration in Fächerform, Japan, vor 1872, Schwarzlack mit Streugold-Dekor © MAK/Georg Mayer
Sammlung von Gegenständen für den täglichen Gebrauch im Besucherzimmer, Japan, vor 1872, Farbholzschnitt © MAK
Strohmarketerie, Japan, vor 1872 © MAK
Ansicht der japanischen Galerie auf der Wiener Weltausstellung 1873 © MAK
Zwei Vasen, Keramik, Satsuma-Ware, Japan, vor 1872 © MAK/Georg Mayer
HASHIMOTO Ichizō I, Lackmustertäfelchen als Stellschirm in Fächerform, Japan, vor 1872 © MAK/Georg Mayer
Moscheeampel, 1379, vermutl. Syrien oder Ägypten, Glas mit Email-Malerei über Blattgold © MAK/Katrin Wißkirchen
YOKOYAMA Takashige, Vase, 1872, Bronze © MAK/Katrin Wißkirchen
Raimund von Stillfried, Fotografie eines japanischen Mädchens, 1863–1883, Albuminabzug, handkoloriert © MAK
TOYOHARA Kunichika, drei musizierende Kurtisanen, Japan, vor 1872, Malerei mit Tusche und Farben auf Seide © MAK/Georg Mayer
MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer
MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer
MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer
MAK Ausstellungsansicht, 2023, Franz Schmoranz, Arabisches Zimmer im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, heute MAK (Rekonstruktion) © MAK/Georg Mayer
MAK Ausstellungsansicht, 2023, Franz Schmoranz, Arabisches Zimmer im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, heute MAK (Rekonstruktion) © MAK/Georg Mayer
MAK Ausstellungsansicht, 2023, WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873 REVISITED. Ägypten und Japan als Europas „Orient“ © MAK/Georg Mayer